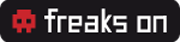Im Zuge der Diskussion rund um ein Verbot von Videospielen in der Schweiz hören gerade wir immer wieder die Aussage, dass man sich Spiele halt im unzensierten Ausland bestellen und von dort aus importieren werde, falls denn ein gesetzliches Verbot entstehen würde. Dies ist aufgrund verschiedener Punkte keine valable Lösung – es bestärkt die Verbotsbefürworter sogar noch in ihrem Unternehmen und wirkt sich negativ auf verschiedene Lebensbereiche aus. Im folgenden Positionspapier erklären wir, weshalb das so ist, und zeigen auf, warum die Schweizer Gamer ihrem Hobby nur schaden, wenn sie eine solche Position einnehmen.
Im Zuge der Diskussion rund um ein Verbot von Videospielen in der Schweiz hören gerade wir immer wieder die Aussage, dass man sich Spiele halt im unzensierten Ausland bestellen und von dort aus importieren werde, falls denn ein gesetzliches Verbot entstehen würde. Dies ist aufgrund verschiedener Punkte keine valable Lösung – es bestärkt die Verbotsbefürworter sogar noch in ihrem Unternehmen und wirkt sich negativ auf verschiedene Lebensbereiche aus. Im folgenden Positionspapier erklären wir, weshalb das so ist, und zeigen auf, warum die Schweizer Gamer ihrem Hobby nur schaden, wenn sie eine solche Position einnehmen.
1) Die Verbotsvorstösse haben den Fall der Einfuhr nicht vergessen
Es mag auf den ersten Blick einfach und praktikabel erscheinen, die lokale Gesetzgebung durch das Bestellen von Spielen im Ausland zu umgehen. Tatsächlich decken die Verbotsforderungen im Bundeshaus aber auch diesen Fall ab. Der Motionstext von Nationalrätin Evi Allemanns Vorstoss «Verbot von Killerspielen», welchem einige andere Motionen praktisch gleichen, geht hierauf klar ein:
Eine Möglichkeit zur Umsetzung der Motion besteht in der Konkretisierung von Artikel 135 des Strafgesetzbuches. Dieser verbietet die Darstellung, Herstellung, Einfuhr, Lagerung, Anpreisung usw. von Ton- oder Bildaufnahmen grausamer Gewalttätigkeiten.
Evi Allemann: «Verbot von Killerspielen», Motion 09.3422 - http://www.parlament.ch/d/suche/seiten/geschaefte.aspx?gesch_id=20093422
Die einzige Methode, um nach der Umsetzung dieser Motion noch legal Videospiele mit «grausamen Gewalttätigkeiten» – eine Begriffsdefinition, welche ohnehin untragbar und viel zu schwammig ist – sein Eigen zu nennen, liegt darin, diese vor Inkraftsetzung des Verbots schon zu besitzen. Alle anderen Bezugswege sind danach verpönt. Auch wer Spiele importiert – und wenn es nur zum Eigengebrauch ist – macht sich im Sinne von Roland Näf, Evi Allemann und ihren Gleichgesinnten strafbar. Ziel ist ganz klar die völlige Verbannung von Gewalt darstellenden Spielen in der Schweiz; dass ein Entzug von bereits gekaufter Software rechtlich undenkbar und administrativ überhaupt nicht durchführbar wäre, liegt auf der Hand; vermutlich würden die Motionäre aber auch das fordern, wenn sie könnten.
Fazit: Ob man es nun irgendwie schafft, ein 18+-Spiel in der Schweiz zu kaufen, oder es irgendwie importiert – sobald das Verbot in Kraft tritt, steht beides unter Strafe.
2) Die hiesige Industrie und der Handel leiden schwer am Umsatzverlust
In der Schweiz profitiert man als Spieler von zumeist akzeptablen Preisen für neue Spiele. Gerade spezialisierte Händler verstehen es, die feilgebotenen Produkte zu möglichst attraktiven Konditionen ein- und auch wieder zu verkaufen. Durch den Verkauf profitiert einerseits der Verkäufer, der dadurch ja seinen Lebensunterhalt bestreitet, aber auch der Konsument, welcher zu attraktiven Konditionen neue Spielsoftware erstehen kann. Gerade damit wird das Fortbestehen von speziell kleineren Spieleschmieden unterstützt, womit man wiederum auf weitere qualitativ starke Titel hoffen darf.
Eine Umsetzung des Verbotes wie oben beschrieben würde dazu führen, dass der Handel einen empfindlichen Umsatzverlust erfährt, nicht mehr wachsen kann und so sein Angebot verwässern muss, um auf dem Markt bestehen zu können. Der Wirtschaftswissenschaftler John Maynard Keynes erkannte schon im frühen 20. Jahrhundert das Gewicht der Nachfrage und erklärte diese zur Hauptdeterminante für die Entwicklung der Produktion – oder einfach gesagt: Solange gekauft wird, wird genügend produziert. Wenn jedoch nicht mehr gekauft wird, verringert sich über kurz oder lang auch die Produktion oder das Angebot: Händler müssen ihre Kernkompetenz ausweiten und im Härtefall sogar Stellen abbauen. Das im Ausland „zusätzlich eingekaufte“ Material fliesst damit auch nicht in landesinterne wirtschaftliche Bestände der Schweiz. Kurz: Spezialisierte Händler müssten fast schon krampfhaft nach anderer Software und ganz anderen Verkaufswerten suchen, um ihre Existenz zu sichern.
Fazit: Wer den hiesigen Handel umgeht, ob nun gezwungenermassen oder freiwillig, schadet der nationalen Wirtschaft, woran wiederum die Spielehändler leiden, was sich weiter gedacht auf die Spielehersteller auswirkt und so – im Extremfall – die ganze Spielelandschaft beeinflussen würde.
Ausserdem: Dass illegale Downloads von Spielen keine Alternative sind und das Angebot (und somit im Endeffekt auch die Menge innovativer, cooler Spiele gerade von kleineren Herstellern) empfindlich schädigen, liegt auf der Hand und muss hier nicht weiter diskutiert werden.
3) Aus Prinzip: Wieso sollten wir uns wegen den moralistisch-polemischen Ängsten einiger weniger bevormunden lassen?
Wer findet, dass er oder sie die Spiele nach einem Verbot einfach im liberaleren Ausland bestellt, demonstriert damit, die Thematik bereits aufgegeben und das böse Schicksal akzeptiert zu haben. Dies zeigt eine «Schlussendlich können wir ja doch nichts tun»-Haltung. Das ist falsch. Die Verbotsbefürworter haben lange nicht so viel Schiesspulver zur Hand, wie sie behaupten: Die Wissenschaft befürwortet noch immer nicht geschlossen einen klar negativen Effekt von Gewalt in Spielen auf die Konsumenten. Die letzte ernsthafte Studie, welche über längere Zeit gesammelte Daten untersuchte, sagt sogar, dass überhaupt kein Zusammenhang zwischen virtueller und echter Aggression bestehe. Unsere GameAgents-Einsätze zeigen überdies, dass in den Köpfen von weniger game-bewanderten Menschen nicht hauptsächlich Angst und Ablehnung, sondern hauptsächlich Unwissen, gezielte Fehlinformation von Verbotsforderern und somit verständliche Skepsis bestehen. Mit beherzten Aktionen und unermüdlicher Information über Medienkompetenz können wir diese Situation verbessern. Niemand soll ein Game-Fan werden, der es nicht will. Oft hören wir nach einem Einsatz jedoch die Worte «so schlimm ist das ja gar nicht». Je mehr Menschen einsehen, dass mit einem Spieleverbot niemandem wirklich gedient ist, desto wahrscheinlich wird ein Nein in der Urne, falls das Verbot einmal eine Volksabstimmung erfahren sollte.
Aus den Taten einer Handvoll Menschen, welche tiefste Depressionen und Aggressionen in sich trugen und im Zuge dessen auf grausame Art und Weise mehrere Menschen töteten, darf auf keinen Fall geschlossen werden, dass ein zufälligerweise gemeinsames Hobby der Täter der Hauptgrund für deren dunkle Psyche ist und dass durch eine gesetzliche Verbannung dieses Hobbys alles zum Guten gewendet wird. Doch nur wer sich hinstellt und klar sagt, dass er oder sie sich nicht kriminalisieren lässt für etwas, das nicht mal bewiesenermassen ebendiesen Hauptgrund darstellt, kann etwas verändern – und wenn das alle Gamer der Schweiz tun, wird es auch nicht zu einem Verbot kommen.
Fazit: Das Importieren von Spielen aus dem Ausland nach einem allfälligen Verbot ist keine Lösung. Eine derart passiv-indifferente Haltung bestärkt nur die aktiven Verbotsbefürworter. Ihnen muss Paroli geboten werden. GameRights tut dies seit fünf Jahren und wird nicht damit aufhören, bis unsere Hauptforderungen in der Schweiz realisiert wurden. Doch dafür brauchen wir jeden und jede von Euch! Es braucht nicht viel; mit ein paar Minuten pro Woche ist schon viel geholfen. Schaut am Besten gleich vorbei was Ihr tun könnt - wir danken Euch!